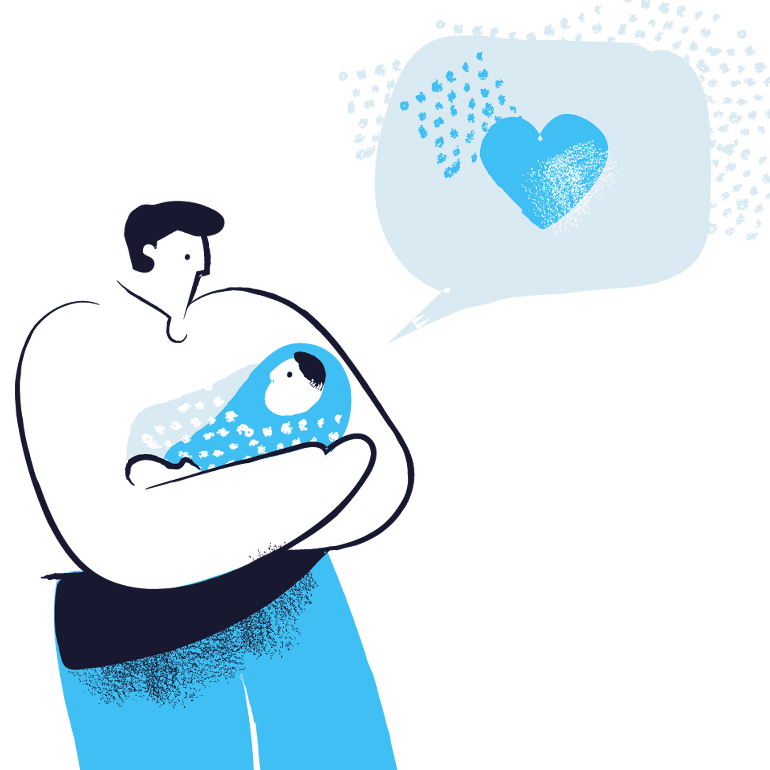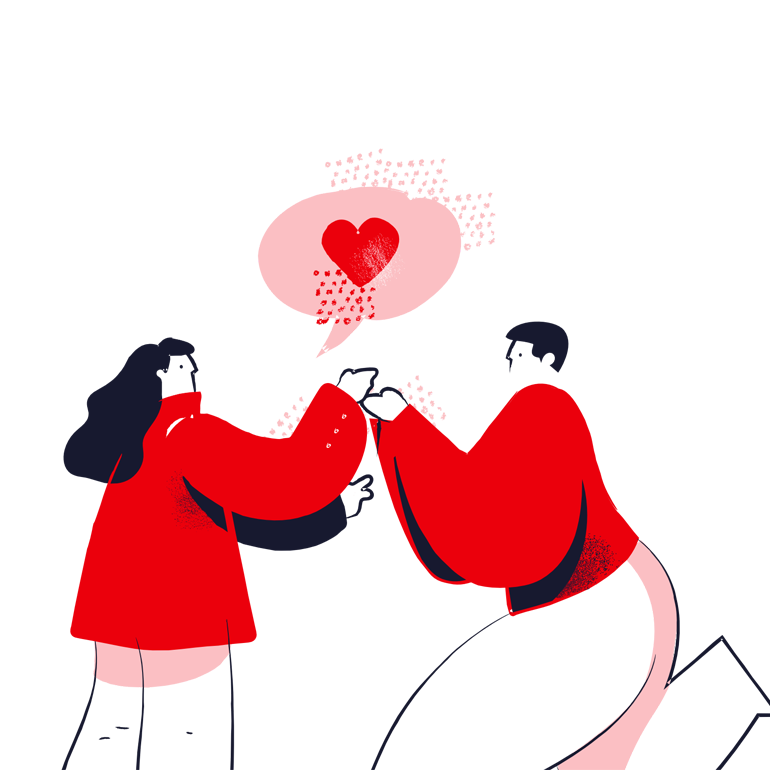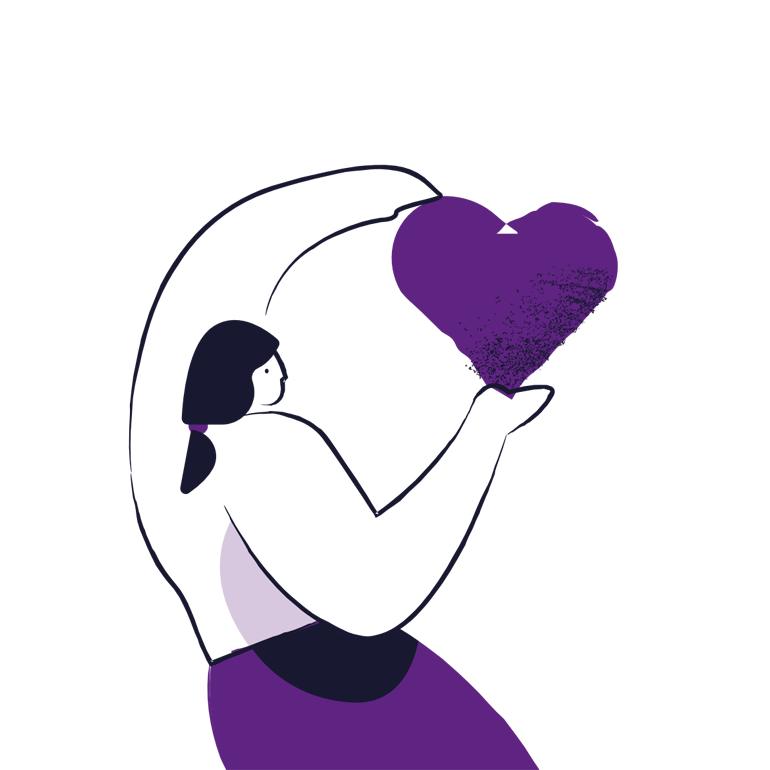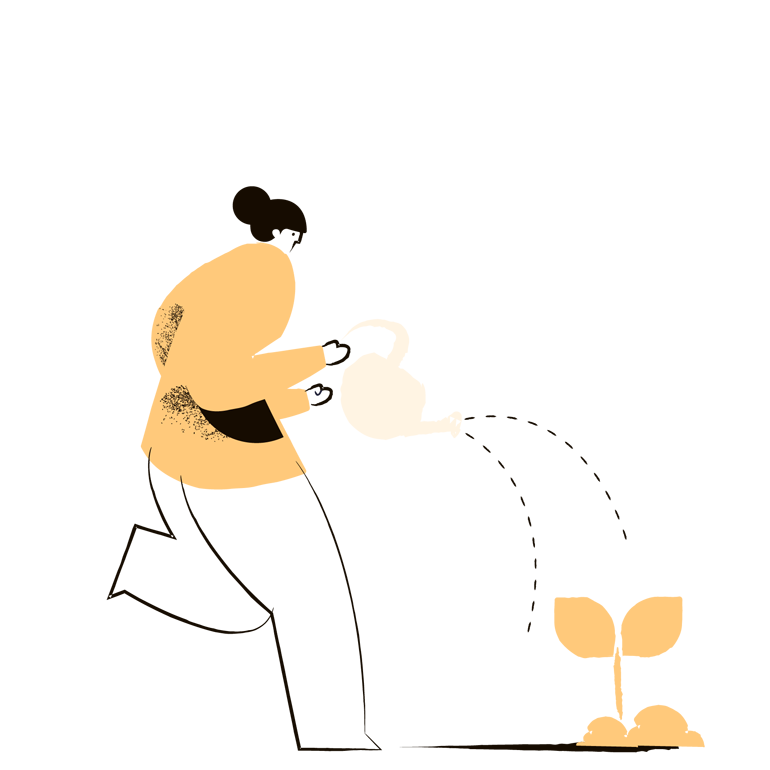Die Kirchensynode beschloss einen Zukunftsfonds von 26 Millionen Euro, der gezielt in Digitalisierung, Klimaschutz und neue Formen geistlichen Handelns investiert wird. Das begleitende Konzept schafft Spielräume zur Erprobung neuer Wege kirchlicher Praxis. ekhn2030 verfolgt in diesem Sinne einen ganzheitlichen Ansatz, dessen Ziel nicht nur finanzielle Stabilität, sondern auch eine Anpassung an die Herausforderungen der Zeit ist.


ekhn2030: Weiterentwicklung der Verwaltungsstrukturen
Die EKHN gestaltet ihre Verwaltung neu, um effizienter und näher an den lokalen Bedürfnissen zu arbeiten. Der Fokus liegt auf der Zusammenarbeit in Nachbarschaftsräumen und der Einführung von Verwaltungsleitungen, um die Organisation zukunftsfähig zu machen.

Nachbarschaftsräume
Die EKHN reagiert proaktiv auf den Mitgliederrückgang und finanzielle Herausforderungen bis 2030. Die Einführung von Nachbarschaftsräumen ist dabei ein Schlüsselelement im ekhn2030-Prozess. Ziel ist es, dass die EKHN trotz zurückgehender Mittel Kirche vor Ort bei den Menschen bleibt. Dafür werden Kirchengemeinden zukünftig in Nachbarschaftsräumen enger zusammenarbeiten.

ekhn2030 - was ist das?
Angesichts der sich abzeichnenden Entwicklung von Kirchenmitgliedschaft und Kirchensteueraufkommen werden wir in der EKHN gemeinsam Priorisierungen vornehmen müssen. Der Prozess ekhn2030 als Zukunftsprozess nimmt aber nicht nur die Reduktion der Kosten in den Fokus. Er verfolgt zugleich das Ziel, die kirchliche Arbeit weiterzuentwickeln.
Artikel

Kirche zu verschenken: Wohnprojekt für junge Menschen mit Handicap
Kirchengemeinde Bad Nauheim der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) verschenkt die Johanneskirche an Förderverein Inklusion e.V. für einen Euro. Die Entscheidung ist Teil des Transformationsprozesses ekhn2030. Sie ist ungewöhnlich, weil Kirchgebäude normalerweise nicht abgegeben werden, sondern im Rahmen von „Kirche kann mehr“ in ihrer Nutzung angereichert werden.

Zuweisungen an Diakonie neu geordnet
Nach einer engagiert und teils hoch emotional geführten Diskussion am Freitag und Samstag hat die Synode der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau auf ihrer Herbsttagung entschieden, die künftigen Zuweisungen an die Diakonie im Rahmen ihres Zukunftsprozesses „ekhn2030“ neu zu ordnen.
Evangelische Kirche ringt um Einsparungen rund um Reformprozess „ekhn2030“
Die Synode der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) hat am Samstag weiter um Konsequenzen aus ihrem Reformprozess „ekhn2030“ gerungen. Einsparungen soll es bei zentralen kirchlichen Bereichen wie Bildung, Verkündigung, Seelsorge und Ökumene geben.